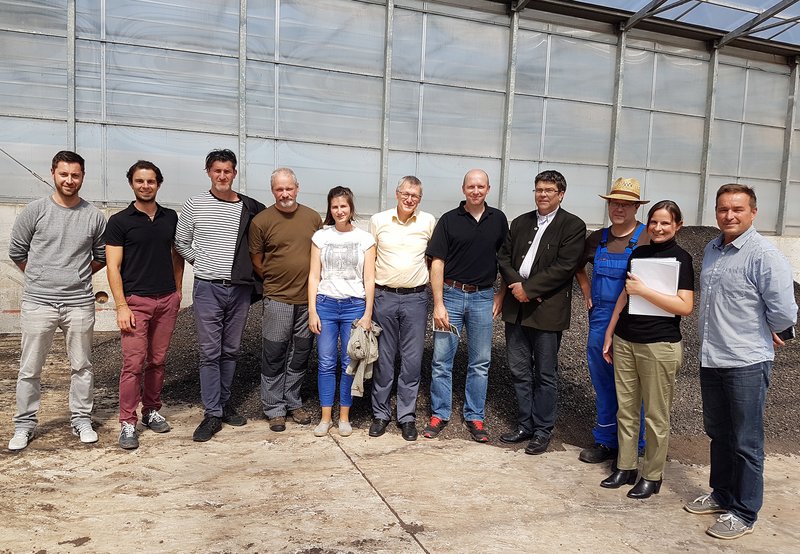Ende August trafen sich die Projektleiterin Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse, Prof. Dr. Josef Hofmann und der wissenschaftliche Mitarbeiter Markus Killinger mit Vertretern der Projektpartner Ikom Stiftland, Chevak und Výzkumný. Die Zielregion des Projekts "greenIKK" ist der Landkreis Tirschenreuth im Osten Bayerns und die Region Tachau/Cheb in Tschechien. Die Projektpartner besuchten das TZE in Ruhstorf sowie die Kläranlagen in Pocking und Wegscheid. Beim Klärwerk Pocking interessierte die Besucher in erster Linie die Trocknung des Klärschlamms. Klärwärter Josef Köck erklärte die Besonderheit der Anlage: Der Klärschlamm wird nicht über konventionelle Energieträger wie Gas oder Strom getrocknet, sondern über Energie aus direkter Sonneneinstrahlung in einem Gewächshaus. „Die Anlage trocknet den Klärschlamm in nur 14 Tagen auf einen Trockensubstanzgehalt von 85 Prozent“ sagte Köck. Da in den Wintermonaten die Sonneneinstrahlung geringer ist und somit weniger Energie zur Verfügung steht, wird der anfallende Klärschlamm in dieser Zeit zwischengelagert. Die solare Trocknung hat den Aufwand für den Abtransport und die Entsorgung in Pocking deutlich reduziert: Die variablen Kosten wurden um rund 75 Prozent gesenkt. „Das könnte auch die Kostenbelastung für die Kunden verringern“, ergänzte Hofmann. Anschließend besuchte die Delegation die kleinere solare Trocknungsanlage der Gemeinde Wegscheid. Bürgermeister Josef Lamperstorfer und Klärwärter Martin Fenzl führten durch die Anlage. „Es dauert vier bis sechs Wochen, bis der Klärschlamm 30 Prozent Trockensubstanzgehalt erreicht hat, das ist relativ lange“, so Fenzl. „Doch die zweite Phase auf 80 Prozent verläuft in nur zwei Wochen.“ Hofmann ergänzte: „Genau für kleine und abgelegene Kläranlagen wie diese ist die solare Klärschlammtrocknung besonders gut geeignet.“ Durch die Auswertung verschiedener Anlagenkonzepte wollen die Projektpartner laut Hehenberger-Risse unter anderem erarbeiten, welches Konzept der Klärschlammbehandlung für die Anlagenbetreiber nachhaltig und wirtschaftlich umsetzbar ist – etwa, ob es unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten sinnvoll ist, Schlamm aus verschiedenen Kommunen in großen zentralen Anlagen gemeinsam oder in kleineren dezentrale Anlagen zu verwerten. Das Projekt „greenIKK“ läuft bis 2020. und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Das nächste Fachgespräch zum Thema wird im Rahmen der Landshuter Energiegespräche am 6. November
am TZE in Ruhstorf stattfinden.
Pressemitteilung als pdf