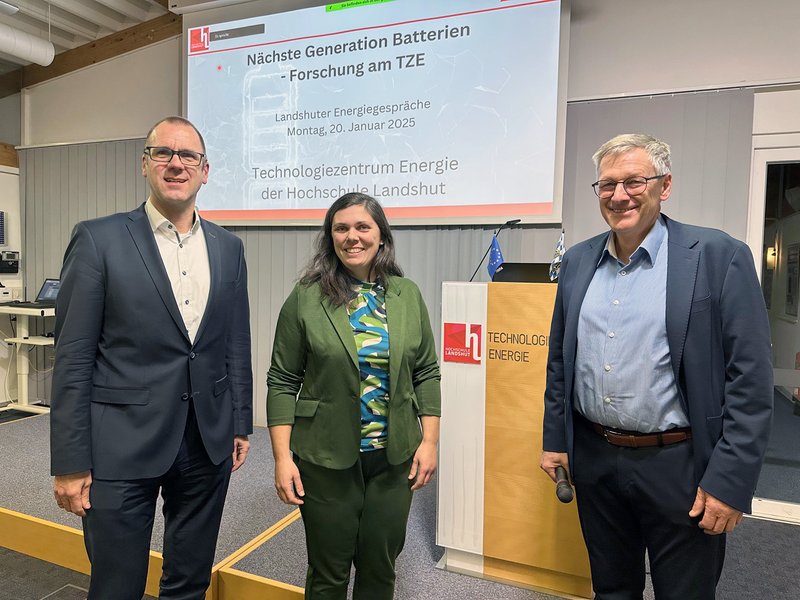Hochschulvizepräsident Prof. Dr. Marcus Jautze freute sich, mehr als 200 persönlich anwesende bzw. online zugeschaltete Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Forschungsstandort des TZE begrüßen zu können. Er bedankte sich bei dem bisherigen wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger, und Geschäftsführer Reinhard Schwaiberger, die maßgeblich dazu beigetragen hätten, dass mit dem Technologiezentrum Energie etwas Einzigartiges im Bereich Batterieforschung entstanden sei. Mit Prof. Dr. Toigo habe „ein Eigengewächs“ die Nachfolge angetreten, die nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am TZE und einigen weiteren beruflichen Stationen in Industrie und Hochschule nun wieder an der Hochschule Landshut tätig sei.
Energiespeicher für Grundlastfähigkeit notwendig
Insbesondere das Thema Energiespeicher sei für die Energiewende von großer Bedeutung, erklärte Veranstaltungsinitiator Prof. Dr. Josef Hofmann in seiner Einführung. Um Zeiten der Dunkelflaute abpuffern und Verbrauch und Produktion in Einklang bringen zu können, seien Speichersysteme unverzichtbar. Auch Prof. Dr. Toigo betonte die Rolle der Energiespeicher für die Energiewende. Der Energieverbrauch in Deutschland habe sich aktuell auf rund 2.500 Terrawattstunden (TWh) eingependelt. Der Stromverbrauch sei etwas rückläufig gewesen, dies aber u.a., weil energieintensive Produktionen ins Ausland verlagert worden seien. Erfreulicher Weise würden mehr als 60 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt. Doch sei nur ein Teil dieser Energieträger grundlastfähig, etwa 50 Prozent des Strommix stammen aus Wind und Photovoltaik und seien daher nicht täglich rund um die Uhr verfügbar.
Die Monate November und Dezember des Jahres 2024 seien sehr dunkelflautenlastig gewesen, kaum Sonne, wenig Wind. Für zwei Wochen Dunkelflaute liege der Gesamtenergiebedarf in Deutschland bei rund 100 Terrawattstunden. Aktuell seien rund 12 Gigawattstunden (GWh) Privat-, Industrie- und Großspeicher im Einsatz. Rechne man auch noch E-Fahrzeuge hinzu – die eigentlich auch als Energiespeicher genutzt werden könnten – beläuft sich die Bilanz auf rund 75 GWh. Nötig wären aber rund 96 TWh, es klafft eine enorme Lücke, die u.a. durch Speicher geschlossen werden sollte.
Viele Aspekte entscheiden über zukünftige Batterietechnologie
Prof. Dr. Toigo gab in ihrem Vortrag zu bedenken, dass die Frage, in welche Richtung die Batterietechnik sich entwickeln solle, nicht so einfach zu beantworten sei und viele Aspekte eine Rolle spielen. Dies zeigte sie am Beispiel der Li-Ionen-Batterien. Sie speichern auf kleinem Raum viel Energie, seien für mobile und stationäre Anwendungen geeignet, hätten aber nur eine mittlere Speicherkapazität und -dauer. Sie so groß auszulegen, dass Energie für den Winter gespeichert werden kann, funktioniere weder technisch noch ökonomisch. Die Leistungsfähigkeit sinke bei niedrigen Temperaturen, zusätzlich stehen die erforderlichen Bodenschätze nur in begrenzten Mengen sowie hauptsächlich in Südamerika und Australien zur Verfügung. Dies schaffe Engpässe und Abhängigkeiten. Weil die Aufbereitung meist in China erfolge, entstünden zudem enorme Transportwege, die einen „CO2-Rucksack“ für jede Li-Ionen-Batterie bedeuten. Dies verhagle die Nachhaltigkeitsbilanz. Die Bedingungen bei der Gewinnung der Bodenschätze müssten zusätzlich berücksichtigt werden.
Die Li-Ionen-Batterie arbeite nach dem "Schaukelstuhl-Prinzip", wandern Lithium Ionen zur Anode werde die Batterie geladen, wandern sie zurück, wende sie entladen. Die aktuelle Forschung – auch am TZE – befasse sich mit besseren, kostengünstigeren und umweltfreundlicheren Materialien, neuen Aktivmaterialien mit einer höherer Energiedichte, verbesserten Sicherheitseigenschaften, erhöhter Ladegeschwindigkeit, der Verwendung alternativer Rohstoffe sowie der Kostenreduktion durch die Optimierung von Herstellprozessen. Ebenfalls sei das Recycling ein wichtiges Thema. Grundsätzlich seien hier aber hohe Investitionskosten notwendig, um den Abstand zu asiatischen Herstellern verringern zu können.
Lithium-Ionen-Technologie weiterentwickeln
Als Kandidaten für die nächste Generation von Batterien sieht sie einerseits die Li-Ionen-Technologie mit verbesserten Eigenschaften, u.a. durch den Einsatz neuer Materialien oder den Ersatz von Lithium Ionen durch Natrium, Magnesium oder Aluminium. Silizium-basierte Batterien seien eine Richtung, problematisch sei dabei die hohe Volumens-Ausdehnung beim Laden und Entladen sowie eine begrenzte Zyklen-Stabilität. Die Kombination zu Silizium-Kohlenstoff-Komposit-Materialien könne eine Lösung darstellen.
Eine weitere Alternative stellen Natrium-Ionen-Batterien dar. Anstelle von Lithium-Ionen wandern Natrium-Ionen zwischen Anode und Kathode. Die Verfügbarkeit der Grundmaterialien sei deutlich besser, Natrium kann leicht aus Meerwasser extrahiert werden, die Umweltbilanz ist damit positiver. Allerdings sei auch die Energiedichte geringer als bei Li-Ionen-Batterien, sie bieten keine Top-Performance. Wegen der deutlich besseren Sicherheitseigenschaften werden in Asien aber erste E-Fahrzeuge mit Natrium-Ionen-Batterien in Serie produziert. Der Einsatz von ebenfalls besser verfügbaren Materialen wie Magnesium oder Aluminium sei eine weitere Möglichkeit, an der momentan geforscht werde. Anwendungsfelder könnten u.a. Industrie- und Großspeicher sein.
Weitere vielversprechende Batterie-Konzepte
Festkörperbatterien, bei denen der flüssige Elektrolyt durch Ionen-leitende, feste Membranen ersetzt wird, seien eine weitere hoffnungsvolle Batterietechnologie. Sie ermöglichen eine verbesserte Sicherheit, chemische Beständigkeit und mehr Materialalternativen. Gerade für Großspeicher seien auch Hybridsysteme wie die Kombination von H2 und Batterien denkbar, wie es die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ biete. Sie biete eine intelligente Kombination von Wasserstofferzeugung und Stromspeicherung per Elektrolyse: Beim Ladvorgang wird eine Zink-Schicht an der Kathode abgeschieden, die Energie gespeichert. Beim Entladevorgang löst diese sich wieder auf und es entsteht zusätzlich Wasserstoff. Es seien keine Membranen, Separatoren oder Edelmetallkatalysatoren notwendig. Die Batterie biete eine hohe Lade- und relativ geringe Entladeleistung.
Für die Speicherung von großen Mengen an elektrischer Energie sei auch die Speicherung in chemischen Verbindungen vielversprechend. Diese könnten viel Energie über lange Zeit mit kaum Kapazitätsverlust speichern. Flussbatterien (Redox-Flow) seien technisch aufwändig, besitzen eine hohe Speicherkapazität, lassen sich nur langsam auf und entladen, eignen sich damit aber hervorragend für stationäre (Groß-)Speicher. Hier seien auch hybride Systeme denkbar, wie der Einsatz zusammen mit einem Superkondensator mit hoher Leistung, an dem am TZE auch geforscht wird.
Insgesamt sieht Prof. Dr. Toigo eine große Bandbreite an Batterie-Technologien für zukunftsfähig an, doch müsse man je nach Anwendungsfeld und Umgebung die geeignete Lösung finden und dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Im Bereich der E-Mobilität wird es für Prof. Dr. Toigo in der nächsten Zeit bei der Li-Ionen-Technologie bleiben, doch könnten Festkörper- und Silizium-Batterien mögliche Alternativen werden. Für stationäre Anwendungen sieht sie Natrium-Ionen-Batterien als Kerntechnologie, die auch bei hohen Minustemperaturen Einsatz finden kann. Die Entwicklung von neuen Batterietypen sei ein langer Weg: Neben der technischen Entwicklung müsse ein Business Case gefunden werden, der den Einsatz und die Produktion auch rentabel mache. Umso unverständlicher sei die drastische Kürzung von staatlichen Fördermitteln für die Batterieforschung.
Landshuter Energiegespräche
Die Landshuter Energiegespräche informieren über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Energietechnik, Energiewirtschaft und Energiepolitik. Nach den Vorträgen besteht jeweils ausreichend Zeit zur Diskussion mit den Referenteninnen und Referenten. Eingeladen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und den Medien sowie Studierende und Hochschulangehörige. Veranstaltet werden die Landshuter Energiegespräche vom Forschungsschwerpunkt Energie, dem Technologiezentrum Energie und dem Institut für Transfer und Zusammenarbeit der Hochschule Landshut, unterstützt werden sie durch die Partner Solarfreunde Moosburg, den Freundeskreis Maschinenbau der Hochschule sowie den Bund der Selbständigen in Bayern (BDS).
zu den Landshuter Energiegesprächen